„How many trolls does it take to change a light bulb?“ Ist es womöglich wirklich das letzte Album, das Green Day in einem vor hundert Jahren unterschriebenen Vertrag mit Warner leisten müssen, mit ihrer Plattenfirma im Zerwürfnis liegen und nun einen Abgang machen, den man selten so offensichtlich mitbekommt oder ist das, was Euch da morgen um die Ohren fliegen wird wirklich zu 100% so gewollt und ich versaue mir hier gerade ernsthaft den Donnerstagabend und eine Band, von der ich eigentlich echt viel halte? Ich weiß, ich weiß, Reviews schreibt man nicht in der Ich-Form; Green Day hört man aber auch eigentlich nicht mit zugeschnürter Kehle und dieser unangenehmen Gänsehaut, die einem absolut gar nichts Gutes ankündigt.
„Green Day, ich glaube Euch keinen einzigen Ton“
Jetzt mal Butter bei die Fische
Nach gefühlt endlosen „Huh uhs“ der ersten beiden Songs „Fathers Of All…“ und „Fire, Ready, Aim“, erlebe ich mich ordentlich entnervt und denke, dass ich die Tastatur beim nächsten undefinierbaren „Ah ah ah“, „Huh uh“, „Yeah“ oder „ooh ooh ooh“ zur Seite lege, vielleicht sogar direkt aus dem Fenster werfe oder einfach verbrenne. Eine gefühlte Sekunde später lese ich den dritten Songtitel „Oh Yeah“ und kann mich bei all dem Zynismus, den das neueste Green Day Album „Father of All Motherfuckers“ innehat nicht mehr zusammenhalten und muss herzlich lachen. Ganz ehrlich, no way!
Green Day, ich glaube Euch keinen einzigen Ton. Auch die Erklärung, dass man den Kommerz-Rock kritisiere, kann man sich gern sparen, besonders, da man nicht zuletzt sogar in Interviews und Statements das Gefühl bekam, dass nicht mal die Band so richtig gut erklären kann, was es mit diesem ungewöhnlichen Anti-Punkrock-Album auf sich hat. Jetzt mal Butter bei die Fische – allein den Albumtitel kann doch kein Mensch ernst nehmen und einigermaßen wirtschaftlich vermarkten. Solltet Ihr also ein ernsthaftes Album im Off haben, nehme ich das gern, aber für dieses hier möchte mein privates Ich nicht mal die Zeit aufbringen, sich das 26 Minuten Werk bis zum Ende anzuhören und ich denke, wir müssen hier noch nicht mal damit anfangen über das unfassbar stilvolle Albumcover zu reden, was man Green Day zwar in einer düsteren Minute zuschreiben könnte, es aber vermutlich auch guten Gewissens lassen kann.
„Rock ’n‘ roll tragedy, I think the next one could be me“
Ein großes „Fuck You“, ein wirklicher Mittelfinger?
Der letzte Strohhalm könnte die Presseinfo sein. Dachte ich. Gibt es aber nicht. In keiner meiner Mails ist ansatzweise etwas Erklärendes zu finden, auf der Seite der Agentur nur die Geschichte der Band und beim Label, da sind die letzten Texte drei Jahre alt. Amüsant sind auch die haltlosen Videobeschreibungen bei Youtube, die gefühlt sowohl ein Auto, einen neuen Green Day Song, aber auch eine Immobilienfirma beschreiben könnten. Das dürft Ihr Euch aber gern selbst zu Gemüte führen. Meine gedankliche Verschwörung gegen dieses Album verstärken sich zunehmend und bei Reddit merke ich schnell, dass ich damit nicht allein bin. Ab dem Rock ’n‘ Roll-Boogie-Woogie-Schmankerl „Steab You In The Heart“ steigt immerhin das Tempo etwas – bis dahin muss man es aber erstmal schaffen und wenn Billy Joe Armstrong dann bei „Junkies On A High“, dem drittletzten Song „Rock ’n‘ roll tragedy, I think the next one could be me“ singt, möchte ich gleichermaßen zustimmend nicken und jämmerlich heulen. Mit spitzer Zunge schreie ich diesem verflixten dreizehnten Album den nächsten Titel „Take The Money And Crawl“ entgegen. Jede Gossip Girl, Pretty Little Liars und Riverdale Folge wird sich um dieses Album zwischen Hipsterie, Classic Rock, Indie-Pop-Konserven und „College Pop-Pünkchen“ reißen, da es dort vermutlich den perfekten Soundtrack mimt – ohne damit eine dieser Serien abwerten zu wollen.
Handwerklich und teilweise auch im Songwriting ist das, was mir gerade die heimischen Boxen verklebt natürlich lupenrein – auch, wenn ich mittlerweile wohl so verhärtet in meiner Theorie bin, dass ich mich hier und da frage, ob Billy Joe nicht wohl absichtlich seine Stimme in ganz besondere Höhen presst, um mein zartes Gemüt noch ein klitzekleines bisschen mehr herauszufordern. „Fathers Of All…“ erschüttert mich – ganzheitlich. Dieses Album darf in meiner Welt einfach nur ein großes „Fuck You“ gegen wen auch immer sein. Dann wäre es fast schon wieder cool, ein wirklicher Mittelfinger nämlich, der nicht einfach nur schnöde „Früher war alles besser: Live aus dem alten ranzigen Proberaum von 1993“ heißt – alles andere funktioniert nicht.
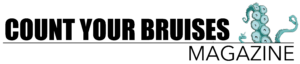
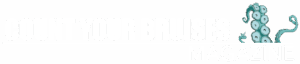

 Green Day – Father Of All…
Green Day – Father Of All…








